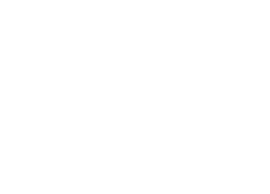Funktioniert Vertrauen auch einseitig?
Nur wenn man nicht merkt, dass es einseitig ist. Vertrauen beruht nämlich ganz entscheidend auf wahrgenommener Gegenseitigkeit. Menschen, die einer anderen Person vertrauen, gehen davon aus, dass ihnen gleichermassen Vertrauen entgegengebracht wird. Es ist wie in der Liebe: Wenn Menschen lieben und überzeugt sind, dass ihre Liebe erwidert wird, ist dies beziehungsfördernd. In unserer Kultur ist Wechselseitigkeit eine wichtige soziale Norm. Nicht ohne Grund laden wir zum Beispiel vor allem diejenigen zum Geburtstag ein, die uns auch schon einmal eingeladen haben. Glauben wir nun Anzeichen zu entdecken, dass unsere vertrauensvolle Haltung nicht erwidert wird, so wird dies als Vertrauensbruch erlebt. In der Konsequenz wird sich das eigene Vertrauen reduzieren.
Warum ist der Massstab für Vertrauen in Liebesbeziehungen bei den meisten Menschen die sexuelle Treue?
Weil Sexualität bei den meisten Menschen den wesentlichen Unterschied zwischen partnerschaftlichen und nicht partnerschaftlichen Beziehungen darstellt. In anderen Bereichen, etwa in der Arzt-Patient-Beziehung, spielt fachliche Kompetenz eine ausschlaggebende Rolle für das Vertrauen, während dieser Aspekt in manch anderen Beziehungen völlig unbedeutend ist.
Sie sind auch als psychologischer Unternehmensberater tätig. Was raten Sie Unternehmensleitungen, die daran arbeiten, ein vertrauenswürdiges Image auszustrahlen?
Vertrauen soll nicht als erstes Ziel ausgestrahlt werden. Vertrauen soll zunächst einmal gelebt werden. Dann wird es zwangsläufig auch ausstrahlen und ist nicht nur ein strategisches Marketingprodukt. Unternehmen müssen dementsprechend Vertrauen für sich als wichtige Ressource im Innen- und Aussenverhältnis begreifen, Unternehmen müssen sich um eine Vertrauenskultur bemühen. Eine spannende Frage zu Beginn von Entwicklungsmassnahmen ist von daher oftmals der Vergleich zwischen den postulierten Leitsätzen und der Philosophie mit dem «tatsächlichen» Leben im Unternehmen.
«Vertrauen soll nicht als erstes Ziel ausgestrahlt werden. Vertrauen soll zunächst einmal gelebt werden.»
Das hören vermutlich die meisten Unternehmensleitungen nicht besonders gern.
Es ist letztlich eine Frage der grundlegenden Haltung einer Unternehmensleitung. Aber gerade mit Blick auf die komplexen Herausforderungen und die Notwendigkeit zur Innovation steigt die Bereitschaft von Organisationen zunehmend, das Wagnis des Vertrauens einzugehen.
Welches Wagnis?
Dass man sich zur Partizipation und Transparenz verpflichtet – und letztlich auch dazu, allfällige Konsequenzen zu ziehen. Wenn es etwa in einem Familienunternehmen am Ende doch nur darum geht, dass der Patron alles alleine bestimmt, können grundlegende Wirkfaktoren zum Vertrauensaufbau nicht greifen, vielmehr provoziert man Enttäuschungen und Frustration. Hochbezahlte Führungskräfte, die nicht an einer Vertrauenskultur innerhalb des eigenen Unternehmens interessiert sind, sind meines Erachtens in der heutigen Zeit auf ihren Positionen nicht mehr tragbar.
Sie betreuen auch Sportler. Wo sind da die Knackpunkte?
Viele Menschen gehen davon aus, dass Hochleistungssportler über ein hohes Selbstvertrauen verfügen – das tun sie aber häufig nicht.
Weshalb nicht? Sie erfahren doch viel Bestätigung durch ihren Erfolg.
Es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen bedingter und unbedingter Wertschätzung. Hochleistungssportler sind Menschen, die sich seit früher Jugend über ihre Leistung definieren und darüber von aussen definiert werden. Durch diese Form der bedingten Wertschätzung erfahren sie, wie wichtig es ist, kontinuierlich erfolgreich zu sein. Auf diese Weise kann die Angst vor dem Misserfolg erheblich steigen. Bedingte Wertschätzung ist per se nicht negativ, es muss aber auch die Erfahrung vorhanden sein, dass man unabhängig von Leistung wertgeschätzt wird, zum Beispiel seitens der Familie oder sehr guter Freunde.
Sie sprechen vom Phänomen «Soccer Mom» oder «Tennis-Papi», also elterlichem Drill?
Nicht unbedingt. Häufig handelt es sich nämlich um sehr subtile und unbeabsichtigte Prozesse. Beobachten Sie mal das Verhalten von Eltern, nachdem das eigene Kind einen Turniererfolg hatte oder aber gescheitert ist. Die Reaktionen der Enttäuschung sprechen für sich, obwohl diese Eltern in den allermeisten Fällen ihre Kinder damit nicht bestrafen wollen.
Wie kommt ein Sportler da wieder heraus?
Der erste Schritt ist die Sensibilisierung für solche Prozesse, verbunden mit der Erkenntnis, warum mögliche Misserfolge so angstbesetzt sind. Dies im Idealfall verbunden mit einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Eltern und Trainern.