Text: Regula Freuler | Bilder: Markus Bertschi | Magazin: Der Kunde im Fokus – Januar 2019
«Medizinische Versorgung ist gewissermassen eine Massanfertigung – jeder Patient ist individuell»

Herr Wiesinger, Sie haben Ihr Amt als CEO der Privatklinikgruppe Hirslanden auf den 1. Januar 2019 niedergelegt. Wenn Sie auf die zehn Jahre zurückblicken: Worauf sind Sie am meisten stolz?
Wir haben es geschafft, einen eher losen Verbund von Spitälern zu einem ernst zu nehmenden Medizinbetrieb zu bündeln. Wir haben durch den Gruppengedanken eine Systematik ins Unternehmen gebracht. Dazu gehört auch die regelmässige, einheitliche Qualitätsmessung für alle Spitäler der Gruppe. Nur so schafften wir es, uns wirklich auf Augenhöhe mit der Konkurrenz zu begeben.
Die Hirslanden-Gruppe ist enorm gewachsen in Ihrer Zeit.
Das ist richtig. Aber uns ging es nie nur um blosses Wachstum. Ich habe kein besseres Standing, nur weil wir statt 13 nun 18 Kliniken haben und statt 1 Milliarde nun fast 1,8 Milliarden Franken Umsatz machen. Die Idee war und ist nach wie vor, dass jeder Patient an jedem Ort zumindest entlang der West-Ost-Achse in der Schweiz die Möglichkeit hat, in die Hirslanden-Welt einzutreten, sei das nun eine Arztpraxis, ein Praxiszentrum, ein ambulantes OP-Zentrum, ein Regionalspital, ein Fachspital oder ein Maximalversorger wie die Klinik Hirslanden oder die Klinik St. Anna. Wir sind dort, wo wir sein wollten – abgesehen von Basel- Stadt. Das haben wir noch nicht geschafft.
«Es ist, als würde der Schiedsrichter bei der Gegenseite mitspielen.»
Welches war die grösste Schwierigkeit in diesem Transformationsprozess?
Das Schweizer Spitalwesen ist kein frei spielender Markt. Das ist ein Problem. Die KVG-Revision 2012, die wir unterstützten, hatte mehr Wettbewerb zum Ziel – aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Kantone haben zu viele Hüte auf. Um eine Metapher aus dem Fussball zu verwenden: Es ist, als würde der Schiedsrichter bei der Gegenseite mitspielen, oder – fast noch schlimmer – er steht bei uns im Goal.
Mit welchen Folgen?
Der Kanton ist der grösste Spitalbetreiber im Land. Zudem setzt er die Tarife fest. Er bestimmt, wer «mitspielen» darf und zu welchen Konditionen. Er reguliert die hochspezialisierte Medizin, und wenn es so kommt, wie ich das befürchte, dann wird er zukünftig auch im ambulanten Bereich noch mehr regulieren können.
Im Zürcher Kantonsrat sind zwei Parlamentarische Initiativen hängig, in denen es um die Festlegung eines Mindestanteils von Grundversicherten in Listenspitälern geht. Die Initiative zielt auf Kliniken wie Hirslanden mit ihrem hohen Anteil an Zusatzversicherten. Wie geht es in dieser Sache weiter?
Der sachlich richtige Kommentar dazu lautet: Wir behandeln 100 Prozent grundversicherte Patienten, denn jeder zusatzversicherte Patient ist auch grundversichert. Damit wäre eigentlich die Diskussion schon vom Tisch – ist sie aber nicht. Natürlich machen es manche Hirslanden gerne zum Vorwurf, dass wir seit vielen Jahren darauf fokussieren, die erste Wahl für den zusatzversicherten Patienten zu sein. Aber das hätte jedes öffentliche Spital zu jeder Zeit auch tun können! Und was viele nicht wissen oder andere nicht wahrhaben wollen: Wir behandeln in der gesamten Gruppe rund 50 Prozent grundversicherte Patienten, an manchen Standorten sogar fast 80 Prozent.
1962 in Hamburg geboren, wusste Ole Wiesinger schon früh, dass er «Leuten den Bauch aufschneiden» wollte. Ab 1980 studierte er zuerst Biologie und Chemie, anschliessend Medizin. Ausserdem liess er sich zum Rettungssanitäter ausbilden und anschliessend zum Notarzt. Dazu kommt ein Gesundheitsökonomie-Studium mit Spezialisierung auf Fallpauschalen. 2004 wurde Ole Wiesinger Klinikdirektor von Hirslanden Zürich. Von Oktober 2008 bis Ende 2018 war er CEO der Privatklinikgruppe Hirslanden und Mitglied des Executive-Management-Teams von Mediclinic International.
Seit einigen Jahren stellen sich die Kantone auf den Grundsatz «ambulant vor stationär». Wie stark setzt das die Hirslanden-Gruppe unter Druck?
Das setzt nicht nur uns, sondern das ganze Gesundheitssystem unter erheblichen Druck. Grundsätzlich ist ein solcher Trend richtig. Einen guten Teil der chirurgischen Interventionen, ja der Interventionen insgesamt, kann man im ambulanten Bereich machen. Das ist günstiger und geht schneller, und vom Patientenkomfort her ist es gar nicht so viel schlechter.
Es klingt nach schneller Abfertigung.
Ja, aber in der Regel mögen das die Patienten. Wer verbringt schon gerne seine Zeit im Spital? Die Frage ist bloss, wie man «ambulant vor stationär» einführt, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Konsequenz.
Ist das System infrastrukturell darauf vorbereitet?
Nein, es gibt zu wenig funktionierende ambulante OP-Zentren. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein weiterer ist: Zu welchem Tarif kann man das anbieten? Gemäss bestehendem Tarmed wird das ambulante Operieren schlecht honoriert. Es werden also die Patienten in der teuren stationären Infrastruktur ambulant operiert, mit teurem Personal, teuren Prozessen, teurem Material, und das zu einem nicht wirklich kostendeckenden Tarif. Das hat schon gewaltige Bremsspuren im System hinterlassen – und zwar bei allen Spitälern in der Schweiz.
Sie sagten einmal, dass man Patienten bei Hirslanden nicht als «Kunden» versteht, sondern als «Gäste» – weshalb?
Schon die Bezeichnung «Kunde» ist ein Fortschritt, denn die übliche Terminologie im Spitalbereich stammt aus dem Strafvollzug: Aufnahme, Entlassung, Verlegung ... Der «Patient» ist der Leidende, und über lange Jahrzehnte fand man diese Bezeichnung im Gesundheitswesen angemessen. Dennoch ist der Perspektivenwechsel vom «Patienten» zum «Kunden» richtig: Spitäler sind Dienstleister – einfach mit einer besonderen Beziehung zum Kunden. Medizinische Versorgung ist gewissermassen eine Massanfertigung, denn jeder Patient ist individuell.
Was ist da noch der Unterschied zum «Gast»?
Wir müssen uns nichts vormachen: Wir verkaufen eine Dienstleistung, die eigentlich keiner will. Wer geht schon gern ins Spital? Da geht es um Krankheit, Schmerzen, Fieber, Medikamente. Darum ist uns das Kundenverständnis so wichtig.
Sie haben selbst lange Zeit als Arzt praktiziert. Wie nah sind Sie heute noch an den Patienten dran?
Leider nicht mehr so nah wie auch schon. Vor allem von der Notfallmedizin konnte ich viel fürs Management lernen. Es gibt viele Parallelen: Man ist immer auf einer Bühne, es ist eine Teamarbeit, man muss Entscheidungen treffen und diese hinterher tragen. Ebenso wichtig sind kommunikative Fähigkeiten. Und, ganz wichtig, man muss mit Stress umgehen können. Es gibt nichts, das ich bisher integral noch lieber gemacht habe als die Notfallmedizin. Aber ich bereue meinen späteren Werdegang nicht. Alles hat seine Zeit im Leben.
Wo hat Hirslanden Verbesserungpotenzial?
An der Schnittstelle zwischen der Klinik einerseits und den Ärzten andererseits, welche den Patienten nachbehandeln, kurz gesagt: beim Austrittsmanagement der Patienten. Aber wir arbeiten daran und befragen alle Patienten kontinuierlich – seit zwei Jahren sogar im internationalen Vergleich. Daraus leiten wir konkrete Massnahmen ab
Wie haben sich die Ansprüche der Patienten in den vergangenen zehn Jahren verändert?
Was sich geändert hat, ist das Wissensniveau der Patienten. Sie kommen mitunter zum Arzt und wissen im Zweifelsfall mehr über die von ihnen vermutete Verdachtsdiagnose als ihr Arzt – was es für diesen tatsächlich schwierig machen kann.
Hat das gestiegene Patientenwissen auch Vorteile?
Durchaus. Früher war die Wissensasymmetrie zwischen Arzt und Patient sehr gross. Das konnte man als Arzt ausgleichen, indem man empathisch auftrat – oder man glich es eben nicht aus und trat als «Gott in Weiss» auf. Darunter litt jedoch die Arzt-Patienten-Beziehung. Diese «Ausgleichsarbeit» fällt heute geringer aus. Wahrscheinlich gibt es Ärzte, die das nicht mögen, aber wenn man mit einem Patienten auf Augenhöhe diskutieren will, ist es eben von Vorteil, wenn dieser schon etwas weiss.
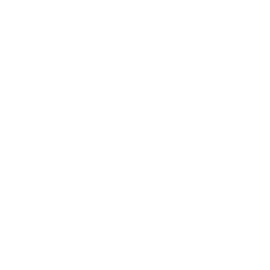
Die Hirslanden-Gruppe betreibt 18 Kliniken mit 1’800 Betten in elf Kantonen und erzielte mit rund 9’600 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von 1,735 Milliarden Franken. Die Privatklinikgruppe formierte sich 1990 aus dem Zusammenschluss mehrerer Privatkliniken und ist seit 2007 Teil der internationalen Spitalgruppe Mediclinic International PLC, die an der Londoner Börse kotiert ist. Die 18 Hirslanden-Kliniken liefern fast den halben Jahresumsatz von Mediclinic. Deren übrige 58 Spitäler mit 9’000 Betten liegen in Südafrika, Namibia und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit dem 1. Januar 2019 ist Daniel Liedtke CEO der Hirslanden-Gruppe.
Das grosse Thema im Gesundheitswesen sind die Kosten. Wo kann man sparen?
Im schweizerischen Gesundheitswesen könnte man die Kosten reduzieren, ohne dass wirklich etwas wegfällt. Dazu braucht es aber einen gesellschaftlich und politisch angestossenen Diskurs darüber, was solidarische Finanzierung heisst. Unsere Krankenversicherung funktioniert wie eine Vollkaskoversicherung. Im Moment lässt sich das halbwegs finanzieren – aber für wie lange noch?
Was schlagen Sie vor?
Es sollte einen solidarisch finanzierten Grundleistungskatalog geben. Alles, was dort nicht enthalten ist, sollte privat versichert werden wie in einem modularen Baukasten. Das ist vielleicht noch nicht mehrheitsfähig, aber ein durchaus realistisches Zukunftsszenario.
In der Kostendiskussion geht es immer wieder um teure Massnahmen am Lebensende. Wie ist Ihre persönliche Haltung dazu?
Auf dieses Eis möchte ich mich nicht begeben. Aber ich glaube tatsächlich, dass man das einmal gesellschaftlich definieren müsste. Vorerst muss es jeder für sich festlegen. Ich halte nichts von der Diskussion über die Bewertung von Lebensjahren. Das wäre ein Irrweg. Aber wir müssen uns dem Thema stellen. In 30, 40 Jahren wird die Lebenserwartung über 90 sein. Wir werden von 100-Jährigen umgeben sein, und diese 100-Jährigen werden noch relativ fit sein und haben dann natürlich auch den Anspruch auf eine entsprechende medizinische Versorgung, zum Beispiel auf eine neue Niere, wenn ihre versagt.
Ethisch gesehen ein heikles Terrain. Wie soll diese Diskussion angeschoben werden?
Klar ist: Jeder Politiker, der das Thema heute in den Mund nimmt, ist seinen Job los. Also braucht es irgendwie einen gesellschaftlichen Effort, eine Art gruppendynamischen Schwarmeffekt. Wann der kommt, weiss ich auch nicht. Tatsache ist, dass im Moment noch sehr viel Geld im System und der Leidensdruck darum vergleichsweise gering ist.
Die Öffentlichkeit scheint aber diskussionsbereit zu sein, wenn es um hohe Preise für Medikamente bei seltenen Krankheiten geht.
Richtig. Das ist die Eisberggeschichte: Oben schaut etwas raus, das ganz offensichtlich ist. Jeder denkt: «Um Gottes Willen, für ein Hepatitis-C-Medikament so viele Tausend Franken!» Aber es führt die Diskussion in die richtige Richtung.
Wenn man in der Hirslanden-Gruppe Grundlagenforschung betreiben könnte: Auf welchem Gebiet sollte das sein?
Grundsätzlich ist die Grundlagenforschung die Aufgabe der Universitäten. Ich persönlich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Krebs eines Tages in den Griff bekommen. Meine andere grosse Hoffnung ist, dass wir nicht mehr von Organspenden abhängig sein werden, sondern dass man aus Stammzellen Organe herstellen kann. Auch das werden wir schaffen.
Ole Wiesinger
Kurze Fragen – kurze Antworten
Ihr persönliches Ziel für 2019?
Ein kluger Mensch hat mir einmal gesagt: «Als junger Mensch fragt man sich, was einem das Leben noch zu bieten hat. Als alternder Mensch dreht man das Ganze um und fragt sich, was man selbst dem Leben noch zu bieten hat.» Eine Antwort auf diese Frage möchte ich 2019 finden.
Der wichtigste Rat, den Sie je bekommen haben?
Weniger ein Rat als ein wichtiger Hinweis, nämlich dass es so etwas gibt wie «systemische Elternschaft». Es bedeutet, dass ich für meine Mitarbeitenden eine ähnliche Verantwortung trage wie ein Vater für seine Kinder. Daraus ergeben sich zentrale Fragen: Wie führe ich Menschen? Wie stehe ich zu meinem Team? Was ist meine Rolle als Chef?
Kino oder Museum?
Kino. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche möchte ich mich zurücklehnen und mich einfach berieseln lassen. In ruhigeren Zeiten gehe ich aber auch sehr gerne ins Museum.
Roman oder Sachbuch?
Roman – was daran liegt, dass ich beruflich so viele Sachthemen lesen muss. Das wird sich in den nächsten Monaten vielleicht ändern.
Ein Rat, den Sie gerne geben?
Jungen Menschen, auch meinen Kindern, sage ich stets: «Bring die Arbeit zu Ende, dann wirst du Erfolg haben.» Ich glaube an menschliche Eigenschaften wie Durchhaltewillen, Beharrlichkeit, Konsequenz, Zielstrebigkeit. Damit wird man immer Erfolg haben.





